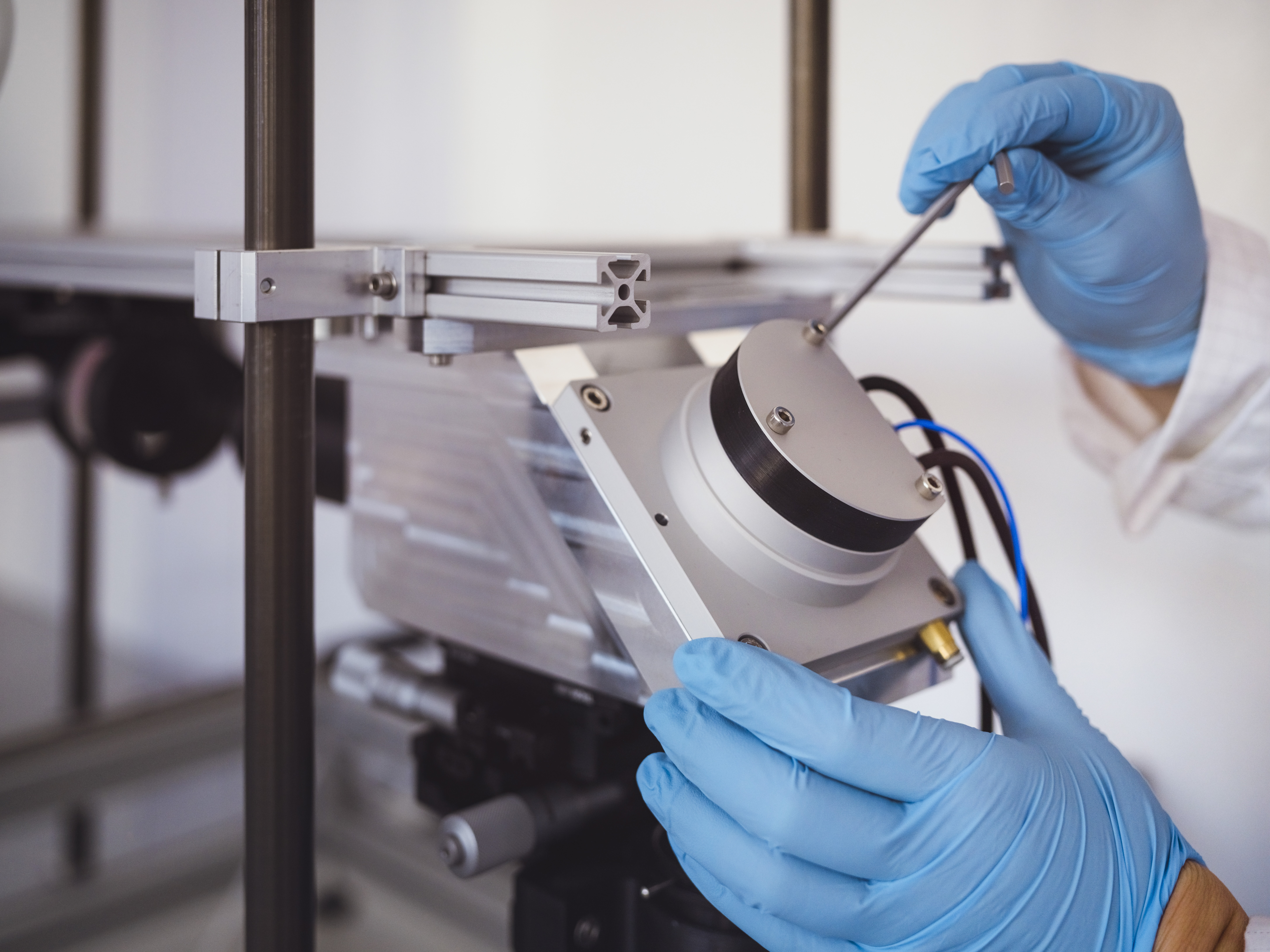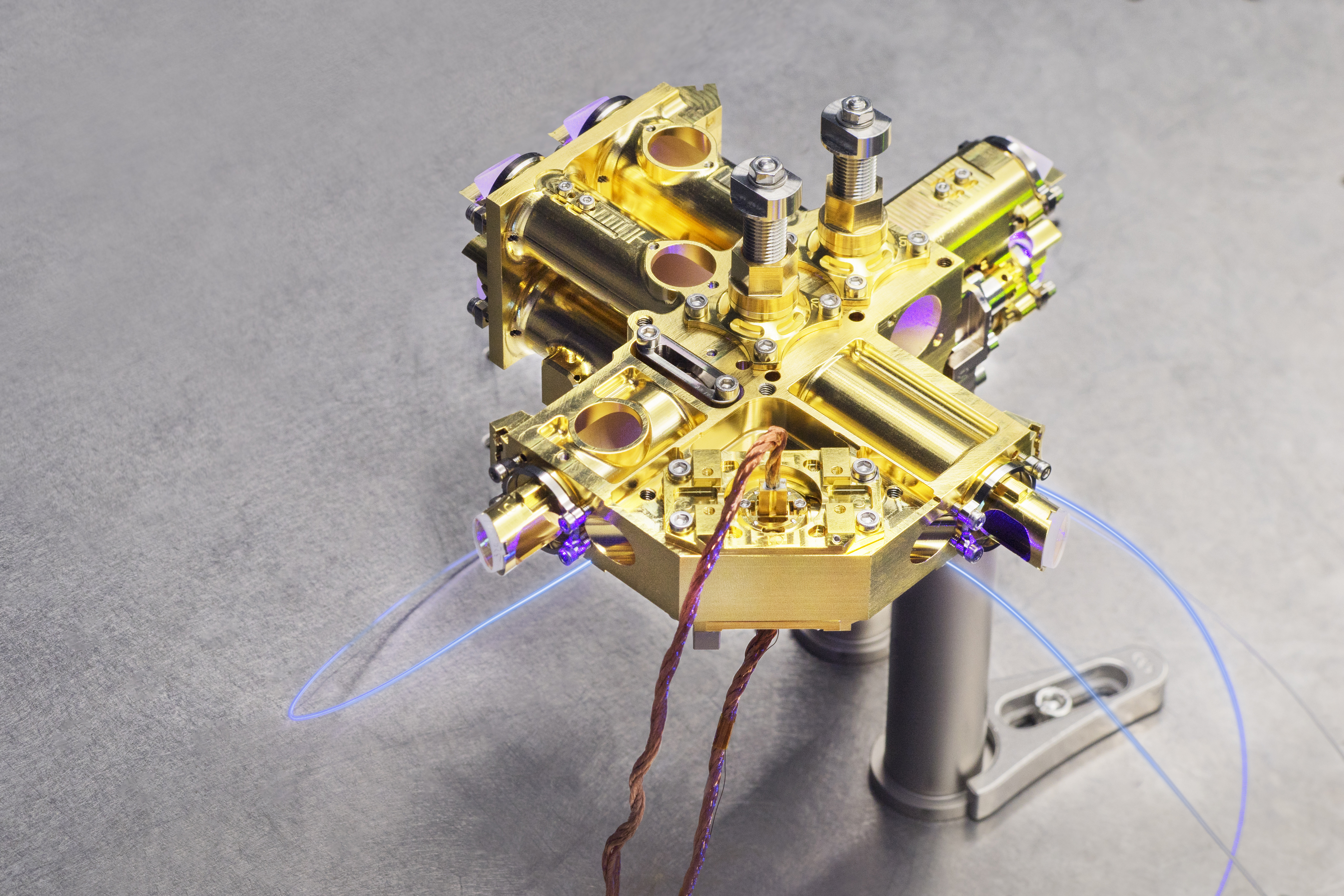Der Zwobbel: innovative Lasertechnik aus der Lichtstadt Jena
10 Zentimeter groß, grau, unscheinbar – was der Zwobbel kann und wie er funktioniert, ist auf den ersten Blick nur für Spezialisten erkennbar. Doch das kleine Stück Technik leistet so einiges: Das Zusatzgerät für Lasermaschinen macht diese bis zu 100-mal schneller, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Entwickelt hat den Zwobbel die Ingenieurin Claudia Reinlein mit ihrem Start-up in Jena. Der Standort ist kein Zufall: Jena ist seit Jahrhunderten ein Innovationszentrum für die optische Industrie. Im „Optical Valley“ von Deutschland treffen engagierte Forschende auf eine gut vernetzte Branche und eine Fülle an staatlichen Fördermaßnahmen.
Ob Forschung oder Start-up: Jena als Zentrum für die adaptive Optik
Claudia Reinlein ist jetzt Unternehmerin. Während es in ihrem alten Job als promovierte Maschinenbauingenieurin am Jenaer Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) um Forschung ging, muss sie sich jetzt auch mit Vertriebsfragen beschäftigen. Ihre Firma ROBUST AO ist ein Spin-off des Instituts und der Universität Jena. AO“ steht für „Adaptive Optik“, die technische Disziplin, bei der es darum geht, optische Systeme qualitativ zu verbessern. Das Start-up ist mittlerweile sogar auf dem japanischen Markt aktiv, die Kundschaft ist international.
Für eine präzise Lasertechnik: Wackeln auf der Z-Achse
Acht Mitarbeitende kümmern sich bei bei ROBUST AO um den Zwobbel. Aber nochmal von vorn: Was genau ist ein Zwobbel eigentlich? Das Prinzip des Zwobbels steckt in seinem Namen: „Zwobbel“ setzt sich zusammen aus dem englischen Verb „to wobble“ – wackeln – und aus dem „Z“ aus „Z-Achse“. Bei der Laserbearbeitung wird ein Laserstrahl auf ein Werkstück fokussiert. Ist dieses zum Beispiel sehr dick, verliert der Laser seinen Fokus auf der Z-Achse. Der Zwobbel gleicht dies mit einer Gegenbewegung aus: Er wackelt mit einem Spiegel, der den Laser lenkt, und erhöht so deutlich dessen Präzision. Das kann die Fertigung stark beschleunigen.
Der Zwobbel kann in bereits vorhandene Lasermaschinen eingebaut werden, etwa in der Metallbearbeitung beim Schneiden oder Schweißen. In der Autoindustrie lassen sich mit dem Zwobbel beispielsweise mehr Bleche in kürzerer Zeit genauer zuschneiden. Das Qualitätsplus ist neben der Geschwindigkeit ein wichtiges Verkaufsargument für das kleine Gerät, dessen Herstellungskosten pro Stück im unteren fünfstelligen Bereich liegen.
Von A bis Zeiss: das „Optical Valley“ Deutschlands
Das Forschungsfeld der adaptiven Optik kommt aus der Astronomie: Seit den 1970er-Jahren werden große Teleskope mit bewegten Spiegeln ausgestattet, um atmosphärische Störungen zu korrigieren. Technologisch ist das komplex; es gibt nur wenige Unternehmen, die sich kommerziell damit beschäftigen. Reinlein möchte der adaptiven Optik breitere Anwendungsbereiche erschließen und sie für industrielle Anwendungen nutzbar machen. Dafür ist sie in der „Lichtstadt“ Jena genau am richtigen Ort.
In und um Jena gibt es mehr als 100 Unternehmen und Einrichtungen im Bereich der optischen Technologien, darunter ZEISS, Jenoptik, das IOF und das Leibnitz-Institut für Photonische Technologien. Deshalb wird Jena auch das „Optical Valley“ Deutschlands genannt.
Jena: Hotspot für Forscher und Gründer
Nicht nur die Forschung hat hier beste Bedingungen, sondern auch der Innovationstransfer in die Wirtschaft: 2024 wurde Jena von der Internet-Plattform „Top 50 Start-ups“ zu einem der zehn wichtigsten Start-up-Zentren in Deutschland gekürt. Als Reinlein im April 2022 mit ROBUST AO loslegte, erhielt sie neben einem EXIST-Gründerstipendium des Bundeswirtschaftsministeriums Unterstützung vom DIHP, dem Digital Innovation Hub Photonics, einem Pilotprojekt des Landes Thüringen, das Ausgründungen im Bereich Photonik fördert.
Aus Sicht der Gründerin gibt es wohl kaum einen besseren Standort. Reinlein zählt die vielen Vorteile auf: die kurzen Wege zu den Entscheidungsträgern, den enormen Pool an potenziellen Mitarbeitenden, insbesondere an der FH und der Uni, oder die Fülle an Fördermöglichkeiten. Und: die Vernetzung innerhalb der Branche. Die ist einzigartig, findet Reinlein: „Wir sind selten direkte Konkurrenten und versuchen uns deshalb zu unterstützen.“